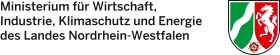Transformationsforschung
Das Motiv ist klar: Wir wollen unser Klima schützen. Dafür gibt es eine breite Mehrheit in der Bevölkerung. Doch wie sieht es aus, wenn es um konkrete Umsetzungen und Maßnahmen vor Ort geht? Hier kann die Transformationsforschung helfen, Lösungen zu entwickeln, die eine breite Zustimmung finden.
Für einen erfolgreichen Wandel hin zur Energiewelt von morgen braucht es Erfolg in vielen und ganz unterschiedlichen Dimensionen. Natürlich geht es um technologische Neuerungen und um Forschung zur weiteren Optimierung einzelner Komponenten und ganzer Prozesse. Natürlich geht es um industrielle Produktionsprozesse und um politische Strategien und Rahmenbedingungen. Aber zu einem sehr großen Anteil geht es bei der Transformation des Energiesystems auch um die gesellschaftliche Akzeptanz, um das Mitmachen-wollen und um den Willen, mit eigenen Handlungen und Initiativen das Ziel Klimaschutz zu ermöglichen.
Die Energiewende wird in der Gesellschaft im Grunde unterstützt: Meinungsumfragen zeigen, dass zum Beispiel die Nutzung erneuerbarer Energien eine breite Zustimmung findet. Dennoch geraten die Entwicklungen ins Stocken, wenn es darum geht, Standorte für Anlagen wie Windräder zu finden oder konkrete Projekte vor Ort zu realisieren. Der so wichtigen gesellschaftlichen Akzeptanz für die Energiewende als Ganzes steht häufig eine zum Teil eher geringe Unterstützung für die konkrete Umsetzung der Energiewende vor Ort gegenüber.

Forschung für und mit der Gesellschaft
Diese Differenzen aufzulösen und die unterschiedlichen gesellschaftlichen Akteure für das gemeinsame Ziel Klimaschutz zu gewinnen, ist eine der zentralen Herausforderungen für die kommenden Jahre. Um dieses Ziel zu erreichen, werden zum Beispiel die Möglichkeiten für Bürgerbeteiligungen ausgebaut. Die Bürgerinnen und Bürger sollen frühzeitig in Planungsprozesse einbezogen werden. Auch finanzielle Anreize sind im Gespräch. Denkbare Modelle sind eine direkte finanzielle Beteiligung am Investment von Windkraftanlagen oder die Verwendung eines Teils der Einnahmen für soziale Zwecke vor Ort.
Transformationsforschung ist die Wissenschaft, die sich mit Veränderungen und Umbrüchen in der Gesellschaft befasst. Ihr Streben ist es, ein besseres Verständnis über die Systemeigenschaften zu gewinnen, Konzepte und Visionen für die Zukunft abzuleiten und reale Veränderungsprozesse zu erforschen. In der Transformationsforschung wird übergreifend zusammengearbeitet: Die Gruppe derer, die sich mit den gesellschaftlichen Fragestellungen beschäftigt, besteht nicht nur aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unterschiedlicher Fachrichtungen, sondern zum Beispiel auch aus Personen, die Industrien und Unternehmen vertreten, sowie aus Bürgerinnen und Bürgern. Durch diese heterogene Zusammensetzung und die unterschiedliche Perspektive, mit der jedes Teammitglied auf die Fragestellung blickt, wird praxisnahes und handlungsorientiertes Wissen erzeugt. Auf dieser Basis können Transformationsprozesse – wie die Transformation hin zu einer klimaneutralen Welt 2050 – beschleunigt und langfristig stabil gestaltet werden.
Im Kern der Transformationsforschung geht es darum, alle gesellschaftlichen Akteure gleichermaßen zu adressieren, die jeweiligen Perspektiven und Präferenzen zu erfassen, Gemeinsamkeiten oder Unterschiede zum Beispiel bei der Einschätzung von Technologien herauszuarbeiten und Transformationspfade zu analysieren. So gelingt es, Diskrepanzen in der Wahrnehmung oder in der Bewertung aufzudecken, Konfliktlinien frühzeitig zu erkennen – und darauf aufbauend Lösungskorridore zu entwickeln, die eine breite Zustimmung und Unterstützung aller Beteiligten erfahren.
Experteninterviews
Interview mit Prof. Dr. Jürgen Howaldt und Jürgen Schultz
„Die Menschen sollen ihre Zukunft aktiv mitgestalten können“

Mit der Energiewende erleben wir heute einen tiefgreifenden Umbruch. Ein anderer, ähnlich triefgreifender Umbruch hat bereits im 18. Jahrhundert stattgefunden: die Industrialisierung. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Transformationsprozessen?
Howaldt: Während der Industrialisierung entwickelten sich nicht nur neue technologische Prozesse, sondern auch ganz neue Organisations- und Lebensformen. Diese ‚große‘ Transformation im 18. Jahrhundert war sicher noch umfassender als die Energiewende heute. Es gibt aber noch einen anderen wichtigen Unterschied: Wir sehen heute, dass unsere Lebensweise zu einer Reihe von ökologischen und sozialen Problemen führt. Deshalb diskutieren wir über den notwendigen Wandel zu einer nachhaltigeren Gesellschaft und Wirtschaft. Dieser Transformationsprozess muss gemeinsam gestaltet werden – ohne dass jedoch ein funktionierendes Vorbild existiert, an dem wir uns orientieren könnten. Das ist einmalig in der Geschichte.
Schultze: Anders als in der Industrialisierung können wir heute auf viele gute, bereits existierende Technologien und auch Verhaltensweisen aufbauen. Bei der Energiewende wird es deshalb auch darum gehen, die technologischen Systeme neu zu kombinieren und in eine neue Gesellschaft zu transferieren – auf sozial gerechte Art und Weise. Auch das ist natürlich ein wesentlicher Unterschied zu der Industrialisierung.
So eine gesteuerte Transformation ist eine große Herausforderung. Und genauso herausfordernd ist das geplante Zeitfenster.
Howaldt: Wie und wie schnell eine Transformation stattfindet, hängt auch stark davon ab, in welchem Land der Erde man sich befindet. Denn Geschwindigkeit ist auch eine Frage der Kultur. Einen starken Einfluss hat natürlich die Politik. So kann zum Beispiel eine konsequente Energiepolitik viel bewegen. Gleichzeitig ist es wichtig, die richtige Balance zu finden zwischen Politik und sozialen Prozessen. Denn die Energiewende ist nicht nur eine wirtschaftliche Transformation, sondern eben auch ein mentaler und damit ein sozialer Prozess, der die Einbindung der ganzen Gesellschaft erfordert.
In Nordrhein-Westfalen sind Wohlstand und Identität der Menschen traditionell sehr eng mit der Kohle verbunden. Beeinflusst das den Transformationsprozess der Energiewende hier im Land?
Schultze: Natürlich, Transformation ist auch eine Mentalitätsfrage. Eine Identitätsfrage. Kohle und Stahl spielten eine tragende Rolle in Nordrhein-Westfalen, die Arbeit in den Zechen prägte das Leben und die Gesellschaft. So entstand in den Städten des Ruhrgebiets der sprichwörtliche, starke soziale Zusammenhalt, der auch heute noch spürbar ist. Wenn es gelingt, diesen Zusammenhalt in die neuen Zeiten hinein weiterzuentwickeln, kann das der Weg zu einer neuen Kultur sein, in der Nordrhein-Westfalen ein neues Selbstbild entwickelt.
Im Zuge des Strukturwandels sind in den letzten Jahren viele tausend Arbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen entstanden. Absolut zukunftsfähige Arbeitsplätze. Zum Beispiel wird jedes zweite Getriebe für die Windenergie in Nordrhein-Westfalen produziert. Solche Schlüsselindustrien, von denen viele hier im Land angesiedelt sind, können ebenfalls zu einem weiterentwickelten Selbstverständnis der Menschen in Nordrhein-Westfalen beitragen.
Können zu dieser Weiterentwicklung auch soziale Innovationen beitragen?
Howaldt: Wenn wir Begriffe wie Energiewende oder Verkehrswende benutzen, denken wir immer noch zu sehr über Technologien nach und zu wenig über die Veränderung von Lebensweisen, von sozialen Praktiken, die eine ganz große Rolle spielen. Ohne soziale Innovationen wird es keine nachhaltigen gesellschaftlichen Strukturen geben.
Schultze: Das Erneuerbare-Energien-Gesetz hat sich zum Beispiel aus sozialen Innovationen entwickelt. Bereits in den 70er und 80er Jahren gab es Kommunen, die lokale Energieversorgungssysteme aufbauten – und damit Alternativen zu Atom- und Kohlekraftwerken aufzeigten. Diese Alternativen wurden vorangetrieben und gefördert, und mündeten schließlich im Erneuerbare-Energien-Gesetz, das Technologien jenseits von Kohle- und Atomenergie eine Chance gab. Durch die im Gesetz vorgesehene Einspeisevergütung wurde die Windenergie schließlich industrialisiert: Es war nicht mehr nur der Bauer, der mit einem einzelnen Windrad Strom erzeugte und ins Netz eingespeiste, sondern es wurden nun große Anlagen entwickelt, onshore wie offshore, die heute ganz andere Dimensionen an Leistung und Energieeffizienz eröffnen.
Gibt es Grundvoraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit soziale Innovationen entstehen können?
Howaldt: Soziale Innovationen entstehen in der Gesellschaft täglich und überall. Es geht jetzt vor allem darum, diejenigen sozialen Innovationen zu fördern und zu verbreiten, die unsere Gesellschaft nachhaltiger machen und uns helfen, die großen gesellschaftlichen Herausforderungen zu bewältigen. Ein großes und noch ungenutztes Potenzial liegt bei den Universitäten: Dort wurden weitreichende Strukturen aufgebaut, um in Kooperation mit der Wirtschaft an technologischen Innovationen zu arbeiten. Für soziale Innovationen sind ähnliche Strukturen für die Kooperationen zwischen Universitäten und Zivilgesellschaft denkbar. So könnten Ideen aus der Zivilgesellschaft von der Forschung, von der Wirtschaft und schließlich auch vom Gesetzgeber schneller aufgegriffen und umgesetzt werden. Dieses Zusammenspiel zu beschleunigen, wäre sicher eine Grundvoraussetzung, um die Wirkungskraft sozialer Innovationen zu erhöhen.
Welche Vision haben Sie diesbezüglich?
Howaldt: Die Innovationspolitik sollte sich nicht nur nach dem wirtschaftlichen Erfolg, sondern auch nach gesellschaftlichen Herausforderungen ausrichten. Innovationen könnten nach ihrem Entwicklungsziel und Nachhaltigkeitsgehalt selektiert werden. Unsere Vision sind großangelegte Förderprogramme und soziale Innovationszentren, die die Gesellschaft dabei unterstützen, ihr innovatives Potenzial zu nutzen – in ähnlichen Dimensionen wie dies im Technologiebereich bereits seit Jahrzehnten üblich ist.
Schultze: Soziale Innovationszentren bedeuten auch Konsensbildung, beispielsweise zwischen großen Energiekonzernen und kleinen alternativen Lösungen. Im Zusammenspiel aus Wirtschaft und kleinen Initiativen können neue Geschäftsmodelle entwickelt werden – und gleichzeitig ein neues Modell des Zusammenlebens.
Ist die Gesellschaft bereit für eine solche Zusammenarbeit?
Howaldt: Bereitschaft und Motivation sind da. Die Frage ist vielmehr, ob wir Wissenschaftler eine umfassende Beteiligung von Akteuren aus anderen gesellschaftlichen Bereichen zulassen. Traditionell sieht sich die Wissenschaft eher in der Rolle, Innovationen in die Gesellschaft zu tragen (die dann allerdings oftmals nicht angenommen werden). Dagegen entwickeln nach unserem Verständnis Wissenschaft und Gesellschaft gemeinsam Innovationen. Projekte nach diesem Verständnis gibt es fast in allen Regionen der Erde. Zum Beispiel absolvieren in vielen Ländern Lateinamerikas Studenten im Rahmen ihres Studiums ein Praktikum in einer Kommune. Jurastudenten bieten Rechtsberatungen an, Studenten der Betriebswirtschaft können beim Erstellen eines Businessplans unterstützen. Gesellschaft und Hochschulen werden auf diese Weise eng miteinander verkoppelt – ohne dass ihre Leistungsfähigkeit abnimmt.
Schultze: Dabei geht es auch insbesondere um den aktiven Teil: Die Menschen sollen ihre eigene Zukunft aktiv mitgestalten können!
Was verbirgt sich hinter der Idee der Befähigung?
Howaldt: Befähigung ist ein ganz wichtiges Thema und wird in der Forschung zu sozialen Innovationen häufig mit dem Begriff „Empowerment“ umschrieben. Empowerment lässt sich am Konzept des „Social Entrepreneurship“ gut erklären: Menschen in Armut sollen nicht langfristig auf staatliche Gelder angewiesen sein, sondern sie werden darin unterstützt, Ideen zu entwickeln und ihre Fähigkeiten und Kompetenzen zu nutzen, um sich selbst aus der Armut zu befreien. „Wir geben den Menschen nicht die Fische, sondern das Netz, damit sie selber fischen können.“ So brachte es eine brasilianische Kollegin auf den Punkt. Im Zusammenhang mit sozialen Innovationen bedeutet Empowerment, die Menschen – insbesondere auch die, die sozial am Rand der Gesellschaft stehen – mit Kompetenzen auszustatten. Aber auch mit Motivation und dem Gefühl, eigene Ideen entwickeln und etwas bewegen zu können.
Schultze: Das gemeinsame Arbeiten an einer Vision ist dafür sehr wichtig. Es geht also nicht darum, die Menschen für die Strategie des Wirtschaftsunternehmens XY zu motivieren und Akzeptanz zu schaffen. Vielmehr möchte man die Gesellschaft emanzipiert voranbringen. Die Richtung wird durch die Vision vorgegeben. Die Vision ist ein gutes Leben in einer neuen Welt. Und das Empowerment nimmt den Menschen die Angst, Bestehendes zu verlieren und mit gewohnten Verhaltensweisen zu brechen. Die eigene Welt anders greifen zu können, auch das ist eine Form von Empowerment.
Kann Empowerment auch Rebound-Effekten vorbeugen?
Schultze: Gerade bezüglich Rebound-Effekten möchte ich die These aufstellen, dass technologische Innovationen alleine in eine Sackgasse führen. Wenn ich zum Beispiel durch eine neue Wärmedämmung im Haus Energie spare und dadurch jeden Monat 50 Euro zurücklegen kann, dann aber am Ende des Jahres von dem gesparten Geld nach Bangkok fliege, ist nichts gewonnen. Und genau das bedeutet Rebound-Effekt: Durch technologische Innovationen erzielte Einsparungen werden (über-)kompensiert durch steigendes Konsumverhalten. Solche Rebound-Effekte lassen sich nur durch die Veränderung sozialer Praktiken vermeiden. Und tatsächlich lassen sich soziale Praktiken auch mit der Frage „Was macht mich glücklich?“ verknüpfen. Ist es wirklich der Flug nach Bangkok? Wir als Wissenschaftler sehen uns auch in der Rolle, alternative Verhaltensweisen gemeinsam mit den Bürgern zu entwickeln und aufzuzeigen.
Howaldt: Heute stellen viele Menschen das auf Konsum ausgerichtete Leben noch zu oft in den Vordergrund und das Nachhaltige nur, wenn es eben noch reinpasst. Es gilt also, soziale Praktiken zu entwickeln, die uns beides ermöglichen: ein reichhaltiges und gleichzeitig nachhaltiges Leben.
Das bedeutet es geht bei der Energiewende nicht nur um Sparen und Verzicht, sondern auch um ein besseres Leben?
Schultze: Genau: Es geht um einen Zugewinn an Lebensqualität. Mehr Platz für Menschen statt für Autos. Höhere Luftqualität. Ausgebauter Öffentlicher Nahverkehr. Mehr Grün und mehr Wasser in den Städten. Es gibt viele Qualitätsvorteile. Die sollten wir nutzen – für ein gutes Leben.